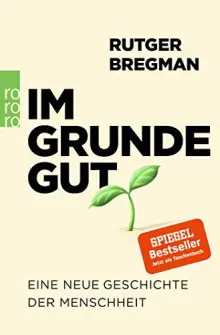Sind wir „im Grunde Gut?“
Rutger Bregmans „Neue Geschichte der Menschheit“
In unserem alltäglichen Leben erfahren wir immer wieder, wie freundlich und fürsorglich Menschen sein können. Es tut gut, sich daran zu erinnern, wie viele Menschen jeden Tag die soziale Stabilität mit bewahren, zum gesellschaftlichen Wachstum und Funktionieren beitragen, auf unterschiedlichste Weise.
Gleichzeitig sind die täglichen Nachrichten erschütternd. Jeden Tag gibt es neue Schreckens-Meldungen. Ständige politische Aggression, Angriffskriege, Katastrophen, allgegenwärtige „fake news“ und schamlose Lügen – all das bedroht unser Sicherheitsgefühl, wir verlieren die Orientierung, oder wir fühlen uns wie ein einer toxischen Beziehung – Machthabern und Entscheidungsträgern hilflos ausgeliefert.
Studien zeigen, dass Naturkatastrophen, obwohl sie verheerende Folgen haben können, emotional besser zu verarbeiten sind als all das Leid, das von anderen Menschen verursacht wird, das, was Menschen einander und der Welt antun.
Wie gehen wir damit um? Wir müssen uns über die Weltlage informieren, aber auch in Kauf nehmen, dass wir dadurch sehr viel negative Energie aufnehmen. Dieses Dilemma zumindest bewusst wahrzunehmen, ist schon ein wichtiger Schritt. Dann können wir versuchen, wieder präsenter zu werden. Und uns nicht nur von den schrecklichen Nachrichten, die natürlich in den Medien dominieren, bestimmen lassen.
Die Medien spielen tatsächlich oft eine eher unglückliche Rolle bei der Verbreitung eines negativen Menschenbildes. Nachrichtendienste berichten – natürlich – über Katastrophen, Kriege, Gewalt, Terrorismus, nicht über den alltäglichen Zusammenhalt. Deshalb brauchen wir als Gegengewicht einen konstruktiven Journalismus, der uns hilft, das größere Ganze zu sehen.
Bei Katastrophen entstehen fast immer Gerüchte über Plünderungen – dabei besagen Hunderte soziologischer Studien, dass das nicht immer stimmt, tatsächlich gibt es bei Katastrophen eine explosive Zunahme von Altruismus. Die große Mehrheit der Menschen kommt dann zusammen, um so viele Leben wie möglich zu retten und um einander zu helfen.
Hobbes oder Rousseau?
Es gibt eine alte Idee in der westlichen Kultur, die so genannte Fassadentheorie, die besagt, dass unsere Zivilisation eine sehr dünne Schicht ist, unter der die rohe menschliche Natur liegt. Angeblich sind wir tief im Inneren alle Wölfe (was den Wölfe gegenüber ungerecht ist, denn Wölfe sind fürsorgliche, soziale Tiere, die im Familienverband leben und gemeinsam die Jungtiere versorgen).
Aber, ob Wolf oder nicht, schon der Philosoph Thomas Hobbes, einer der bedeutendsten Philosophen der Aufklärung, argumentierte, der Mensch sei ein unsoziales Wesen, dessen kriegerische und zerstörerische Triebe im Wesentlichen nur durch eine autoritäre Kraft, einen mächtigen „Leviathan“, eingedämmt werden können. In Freiheit werde der Mensch unweigerlich zum wilden Tier. Im Gegenzug für den Verzicht auf unsere Freiheit erhielten wir – durch die staatliche kontrollierende, den Naturzustand zähmende Gewalt – Sicherheit voreinander.
Jean-Jacques Rousseau hielt dagegen die Zivilisation für die wahre Verderbnis. Die Zivilisation riss die Menschen aus ihrem seligen Naturzustand, raubte ihnen die Freiheit, sie erst formte Menschen zu Egoisten. Rousseau zufolge begann der Niedergang der Menschheit mit der Erfindung des Privateigentums, damit, dass die ersten Menschen ein Stück Land als ihr eigenes deklarierten. Rousseau betrachtete die Zivilisation also nicht als Segen, sondern als Fluch.
Das Beispiel der Höhlenmalereien scheint Rousseaus Sicht zu bestätigen: Unter den Hunderten von Höhlenmalereien findet sich keine einzige Darstellung von Kriegsführung aus dieser Zeit. In unserer Frühgeschichte finden sich nur sehr wenige Hinweise auf militärische Konflikte, diese scheinen erst mit dem Aufkommen der sesshaften Lebensweise begonnen zu haben.
Dennoch wurde jahrhundertelang die Sicht Thomas Hobbes´ als realistischer angesehen, während Rousseau als revolutionärer Romantiker mit radikalen unrealistischen Ideen galt.
Neueste Erkenntnisse aus Archäologie und Anthropologie legen jedoch nahe, dass der Mensch aufgrund seiner sozialen Fähigkeiten überlebt hat, dass wir also weniger vom „survival of the fittest“, sondern vom „survival of the friendliest“ sprechen könnten.
„Survival of the friendliest“
Warum ist dann der Glaube so stark, dass wir von Natur aus nicht gut, sondern eigentlich böse sind? Der niederländischer Historiker, Autor und Aktivist Rutger Bregman widmet sich in seinem Bestseller „Human Kind“ dieser Frage.
Human „Kind“ (engl. „freundlich“) ist hier natürlich ein Wortspiel, was auch die deutsche Übersetzung des Titels „Im Grunde gut“ versucht, widerzuspiegeln.
Sind wir Menschen also „Im Grunde“ gut? Angesichts all der Gräueltaten in unserer langen Menschheitsgeschichte ist unser Glaube daran erschüttert. Wir sind wohl die grausamste Spezies im Tierreich. Wir tun schreckliche Dinge. Einerseits.
Andererseits ist eine sehr große Zahl von Forschern aus den unterschiedlichsten Disziplinen, von der Anthropologie und Archäologie über die Soziologie bis hin zur Psychologie, von einer eher zynischen Sichtweise der menschlichen Natur zu einer hoffnungsvolleren Perspektive gekommen, nach der die Fürsorglichsten überlebt haben. Um zum Beispiel in der extrem rauen Umgebung der Eiszeit zu überleben, brauchte man Freunde.
Ausgestattet, um zu kooperieren
Auf besondere soziale Fähigkeiten verweisen auch zahlreiche unserer körperlichen Merkmale: Der Mensch ist das einzige Lebewesen im gesamten Tierreich, das erröten kann. Als persönliche Erfahrung mag es unangenehm oder sogar beschämend sein, aber evolutionär gesehen geben wir so die Information über unsere Gefühle unwillkürlich an andere Mitglieder unserer Spezies weiter.
Und auch unsere Augen sind einzigartig: Wir können sehen, wohin unser Gegenüber schaut. Wir sehen, dass wir einander ansehen. Für Schimpansen ist dies schwieriger, da bei ihnen, wie bei allen anderen Primaten, die Lederhaut um die Iris dunkel ist – wodurch es schwerer ist, dem Blick zu folgen. Doch wir Menschen offenbaren einander unseren Blick, was Verständnis und Vertrauen schafft.
Und wir haben Spiegelmechanismen im Gehirn, d.h. Nervenzellen, die sowohl aktiv sind, wenn wir bestimmte Handlungen oder Gefühle erleben, als auch, wenn wir diese nur beobachten – dies ermöglicht Lernen durch Imitation, aber eben auch Verständnis füreinander: wir können fühlen, was unser Gegenüber fühlt.
Auch in der Sexualität sind Menschen bezogener aufeinander als andere Säugetiere – tatsächlich sind Fortpflanzung und Sexualität, bei denen die Partner einander zugewandt sind und einander in die Augen schauen können, bei Säugetieren selten. Die Evolution hat uns Menschen offensichtlich dazu geschaffen, uns zu verbinden, einander zu verstehen, einander zu vertrauen.
Macht korrumpiert
Doch zurück zu Bregmans „Human kind“ – eine kurze Zusammenfassung des Buches könnte lauten: Menschen sind grundsätzlich gut, aber allzu oft korrumpiert.
Wenn wir an Kriegsgeschehen denken, stellen wir uns vielleicht vor, dass Soldaten, die in den Krieg geschickt wurden, sofort auf den Feind schießen. Tatsächlich wissen wir aus Geschichte und Psychologie, dass es Menschen sehr schwerfällt, einander Gewalt anzutun. Die überwiegende Mehrheit der Soldaten ist nicht ohne weiteres in der Lage, auf den Feind zu schießen. Sie müssen erst dementsprechend konditioniert werden.
Die meisten Kriegstoten sterben durch Artilleriefeuer; es ist psychologisch viel einfacher, eine größere Anzahl von Menschen per Knopfdruck aus der Ferne zu töten. Das macht die Sache nicht besser, aber es regt uns zum Nachdenken an: Sind wir wirklich so gewalttätig, wie wir annehmen? Was passiert mit Soldaten, die im Krieg tatsächlich töten? Sie zerstören oft auch etwas in sich selbst. Das zeigte sich auch daran, dass viele Soldaten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aus Kriegsgebieten zurückkehren.
Im Interview sagt Rutger Bregman schlicht: „Töten ist nicht gut für uns“ – im Gegensatz zu Essen, Sex oder sozialem Zusammensein. Das sind Dinge, die wir genießen und die evolutionär gesehen auch gut für unsere Spezies sind und unser Überleben sichern.
„Human Kind“ zeigt uns auch, dass Menschen, die grausame Taten begehen, dies vor sich und anderen legitimieren müssen, sich selbst davon überzeugen müssen, dass ihre Taten richtig oder zumindest gerechtfertigt sind. Mitunter entstehen so ganze Glaubenssysteme, die der Rechtfertigung dienen – um das tiefere Wissen um das eigentlich Gute nicht mehr aufkommen zu lassen.
Zudem ist Macht, so Bregman, eine äußerst gefährliche Droge, die korrumpiert. Wenn wir mächtig werden, die Karriereleiter hinaufsteigen, werden wir einsamer, isolierter und es fehlt uns der Austausch mit anderen, die uns spiegeln oder auch korrigieren. Das zeigt sich deutlich bei vielen Autokraten; sie sind das eindrücklichste Beispiel dafür, wie korrumpiert und losgelöst man durch Macht vom Rest der Menschheit werden kann. Wir brauchen also einander, auch als Korrektiv.
Lange haben wir uns einreden lassen, dass wir einander nicht vertrauen können und dass Menschen grundsätzlich egoistisch sind. Das dient auch der Rechtfertigung von Hierarchien und Ungleichheit, denn wenn wir einander nicht vertrauen können, brauchen wir Herrschende, denen wir die Macht übertragen. Wenn Menschen einander wirklich vertrauen würden, hätte dies radikale Auswirkungen –darauf, wie wir unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, unsere Schulen und das Strafrecht gestalten.
Kein Optimist, aber voller Hoffnung
Rutger Bregman sagt von sich selbst, er sei „kein Optimist, aber voller Hoffnung“. Hoffnung bedeutet für ihn, dass die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Dass sie anders und besser werden können. Der kleine Setzling auf dem Buchcover der deutschen Ausgabe ist vielleicht ein Sinnbild dafür: Wir sind „grundsätzlich gut“, aber wir müssen dieses Gute kultivieren, damit das Potential wachsen kann.