Die Kunst des Nicht-Wissens
„Wir können unsere Probleme nicht mit derselben Denkweise lösen, mit der wir sie geschaffen haben.“ Albert Einstein
Unsere gegenwärtige Lage ist ambivalent – während wir mit der Metakrise konfrontiert werden und besorgt sind beim Blick in die Zukunft, erleben wir die konkrete Welt um uns herum meist noch immer als relativ beständig. Wir leben noch immer in mehr oder weniger sicheren und demokratischen Strukturen. Das ist die Welt, die wir kennen, die sich jedoch immer schneller verändert.
Wir gingen lange Zeit davon aus, dass das Leben durch all den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt für alle immer besser werden würde. Erst allmählich haben wir als Gesellschaft die Zuversicht und den unbegrenzten Optimismus verloren. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass es den Generationen, die nach uns kommen, besser oder auch nur genauso gut gehen wird wie uns heute.
Deshalb sind Veränderungen längst nicht mehr nur positiv besetzt. Veränderungen, die sich so viel schneller vollziehen, und die weitaus beunruhigender sind, als wir es uns vorgestellt haben: politisch, gesellschaftlich, ökologisch, wirtschaftlich. Der Verlust der vertrauten und sicheren alten Welt bringt Angst, Widerstand und Orientierungslosigkeit mit sich; Gefühle, die wir nicht gerne spüren.
Die Bereitschaft zum Nicht-Wissen
Gleichzeitig fordert jede Veränderung uns dazu auf, dass wir uns dem Neuen stellen, daran wachsen und neue, ungewohnte Wege finden. Dazu brauchen wir Offenheit. Mit anderen Worten: Bereitschaft zum Nicht-Wissen. Wie gelangen wir zu neuem Wissen, solange wir nicht erst einmal Nicht-Wissen?
A. H.Almaas schrieb dazu: „Wir neigen dazu, Angst vor dem Nichtwissen zu haben; wir können nicht erkennen, dass es die allgegenwärtige Grundlage unseres Wissens ist. Nichtwissen ist in gewisser Weise der Ort, an dem wir ständig leben.“
Diese „Kunst des Nichtwissens“ ist ein wichtiger Aspekt der Arbeit von A.H. Almaas und des von ihm begründeten Ansatzes des „Diamond Approach“ (Sein Autorenname „Almaas“ bedeutet im Arabischen „Diamant“). Die zentrale Praxis seiner spirituellen Schule ist eine unmittelbare und ergebnisoffene Beobachtung und Erforschung des eigenen Erlebens im Moment – mit einer Haltung der Achtsamkeit, Neugier und Präsenz. Da wir diese Art der „inquirys“ sehr schätzen und auch selbst praktizieren, möchten wir Almaas und den Diamond Approach hier etwas genauer vorstellen.
A.H. Almaas und der „Diamond Approach“
A.H. Almaas wurde 1944 als Abdul Hameed Al Ali in Kuwait geboren, wo er in einer traditionell islamischen Familie aufwuchs. Mit knapp zwei Jahren erkrankte er an Kinderlähmung und brauchte seitdem eine Gehhilfe. In einem Interview sagte er einmal darüber: „Dies führte zu einer Verletzlichkeit und körperlichen Abhängigkeit von anderen, was mir half, ein sozial sensibles Individuum, aber auch innerlich autonom zu werden. Es gab mir auch die Notwendigkeit, mich nach innen zu wenden, um das Leben zu erfahren. (…) Die Polio schränkte meine körperliche und soziale Funktionsfähigkeit ein, ermöglichte aber auch die Entwicklung innerer Stärken.“
1963 zog er in die USA, um in Berkeley Physik und Mathematik zu studieren. In der College-Zeit gab es ein zweites Ereignis, das ihn – wie die Polioerkrankung in der Kindheit – entscheidend prägte. Nach einem Verkehrsunfall lag er für einige Zeit auf der Intensivstation. Im Moment des Unfalls erlebte er sich selbst als „einen facettenreichen Körper aus Licht und Präsenz“, er vergaß diese Wahrnehmung zunächst wieder und behielt nur ein unbeschwertes Grundvertrauen, dass das Leben und die Existenz gut sind und das Richtige geschehen wird. Im Nachhinein erlebte er den Unfall als Wendepunkt seiner Aufmerksamkeit – vom äußeren Studium des Universums zur inneren Erforschung, ein allmählicher Entdeckungsprozess, der immer weiter ging und in dem er eine Lehre entwickelte, die, wie er sagt „die alte Weisheit verkörpert, aber für eine postmoderne westliche säkulare Wissenschaftskultur relevant ist.“
Nach dem Bachelor in Physik und Mathematik sowie dem Master in Physik brach er sein Promotionsstudium in Physik kurz vor der Dissertation ab: „Mit Ende zwanzig (…) wurde mir klar, dass ich in Wirklichkeit nach einer Wahrheit über das Universum suchte, die den Wissenschaften damals noch nicht zugänglich war. Etwa zur gleichen Zeit wurde mir bewusst, was für Menschen die meisten Wissenschaftler waren, und dass ich nicht so sein wollte. Ich wollte nicht hauptsächlich intellektuell orientiert sein, auf Kosten anderer menschlicher Fähigkeiten und Qualitäten. Ich erkannte, dass die Wahrheit, nach der ich gesucht hatte, ohne es explizit zu wissen, die ontologische und metaphysische Grundlage der Existenz war. Ich erlebte einige Jahre, in denen mein Interesse an den Wissenschaften schwand, während mein Interesse an der Erforschung innerer Erfahrungsweisen zunahm. Das war eine radikale Wende, und ich durchlebte deswegen viele Ängste. Ich tat es nicht absichtlich; es geschah einfach. Ich empfand es nie als Abwertung der Wissenschaft, denn ich interessiere mich immer noch dafür und schätze sie für das Schicksal der Menschheit. Ich erkannte einfach, dass sie nicht der Weg war, der mich zu meiner Bestimmung führen würde.“
Einige Jahre später promovierte er in Psychologie mit Spezialisierung auf Reichsche Therapie. Und er gründete den „Diamond Approach“, in dem er spirituelle Traditionen mit den heutigen psychologischen Erkenntnissen über unsere menschliche Natur verbindet. Die wichtigsten Methoden in der spirituellen Schule sind Vorträge, Austausch in Groß- und Kleingruppen, Einzelarbeiten, Meditation und die kontemplative Selbsterforschung in Präsenz, die „inquirys“.
All das ist unterstützend, um sich selbst neu zu entdecken und mit all den Facetten des komplexen Lebens umzugehen. Es ist ein sehr sinnvoller Weg, Herausforderungen besser zu meistern. Dieser Ansatz hilft uns aber auch, erst einmal wahrzunehmen, wann wir nicht offen sind, oder bereits alles zu einem Thema zu wissen glauben. Indem wir das hinterfragen, werden bisher unbewusste Überzeugungen deutlicher, und wir können uns neu ausrichten.
Das Potential des Nicht-Wissens
„Es ist unmöglich für einen Menschen, etwas zu lernen, von dem er glaubt, es bereits zu wissen.“ Epiktet, römischer Stoisker
Die meisten von uns haben in der Schulzeit erfahren, dass Wissen geschätzt wurde, Nicht-Wissen dagegen überspielt werden musste. Eine offene spontane Neugier war meist nicht willkommen, wenn sie nicht zum Ziel des Lehrplans führte. Einem Lehrer auf seine Fragen zu antworten: „Ich habe keine Ahnung, aber ich bin neugierig“ – das wäre geradezu absurd gewesen. Die richtige Antwort zu wissen wurde erwartet und führte zu guten Noten.
So sind wir in die Welt der Daten, der Informationsflut und des wissenschaftlichen Wissens hineingewachsen. Und müssen das Nicht-Wissen erst wieder für uns entdecken.
„Nichtwissen ist der Einstieg in das Abenteuer der Entdeckung. Mit der Zeit werden Sie vielleicht erkennen, dass Nichtwissen der Weg ist, in dem sich das Sein dem Mysterium des Lebens öffnet.“ Diamond approaach Glossary
Demut ist das Anerkennen all dessen, was wir nicht wissen. Demut mach uns Neuem gegenüber offener und bewahrt uns vor Arroganz und Selbstüberschätzung. Der optimale Weg ist natürlich ein Tanz des Wissens und Nichtwissens, ein Zusammenspiel von Wissen und Offenheit für Unbekanntes.
Der „Diamond Approach“ ist keine Flucht vor der Realität, sondern ein Ansatz, der uns befähigen soll, angemessene Antworten auf neue Situationen zu finden. Gerade in der heutigen Welt, die so im Umbruch ist.
In Bezug auf die globale Krise schreibt Almaas: „Nichts davon (von der Kostbarkeit von Neugier und Nichtwissen) mindert auch nur im Geringsten die Würdigung des Ausmaßes des Leidens, der Schwierigkeiten und der Tragödien, die sich für manche Menschen entfalten. Neugier ist nicht alles, was wir brauchen. Wir brauchen auch unser Mitgefühl, unser geerdet sein, unseren Mut und viele weitere Eigenschaften. Aber unsere Leichtigkeit, unsere Neugier und Kreativität können alles berühren, was uns begegnet – „wie ist das, was kann ich hier tun, was hilft wirklich?“ Sie kann die Schwere der Situation lindern.“
Weiterführende Literatur: A.H. Almaas hat viele Bücher geschrieben. Zum Einstieg eignet sich besonders: „The Unfolding Now“, in dem der Zugang zum „Inquiry“ anschaulich beschrieben wird.
Eine Einführung in die Praxis der Selbsterforschung auf Deutsch findet sich im Buch: „Sich selbst erforschen. Als tägliche Praxis und spiritueller Weg“, Josef Rabenbauer, Gabriele Michel, Arbor Verlag
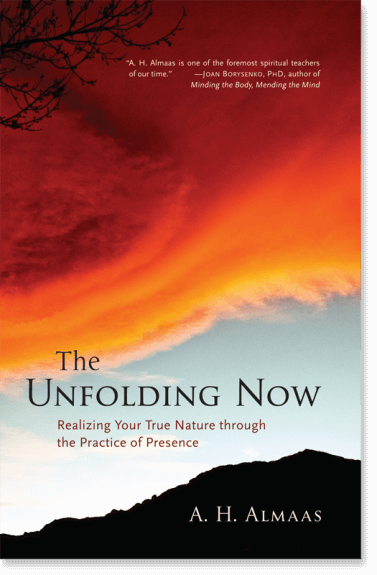
A. H. Almaas, The Unfolding Now.
Realizing Your True Nature through the Practice of Presence
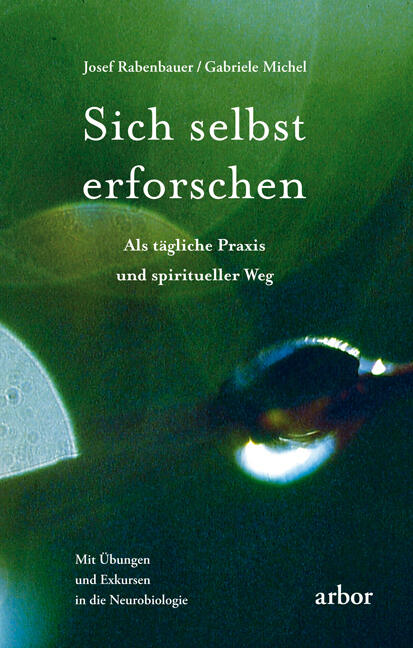
J. Rabenbauer, G. Michel. Sich selbst erforschen.
Als tägliche Praxis und spiritueller Weg.





