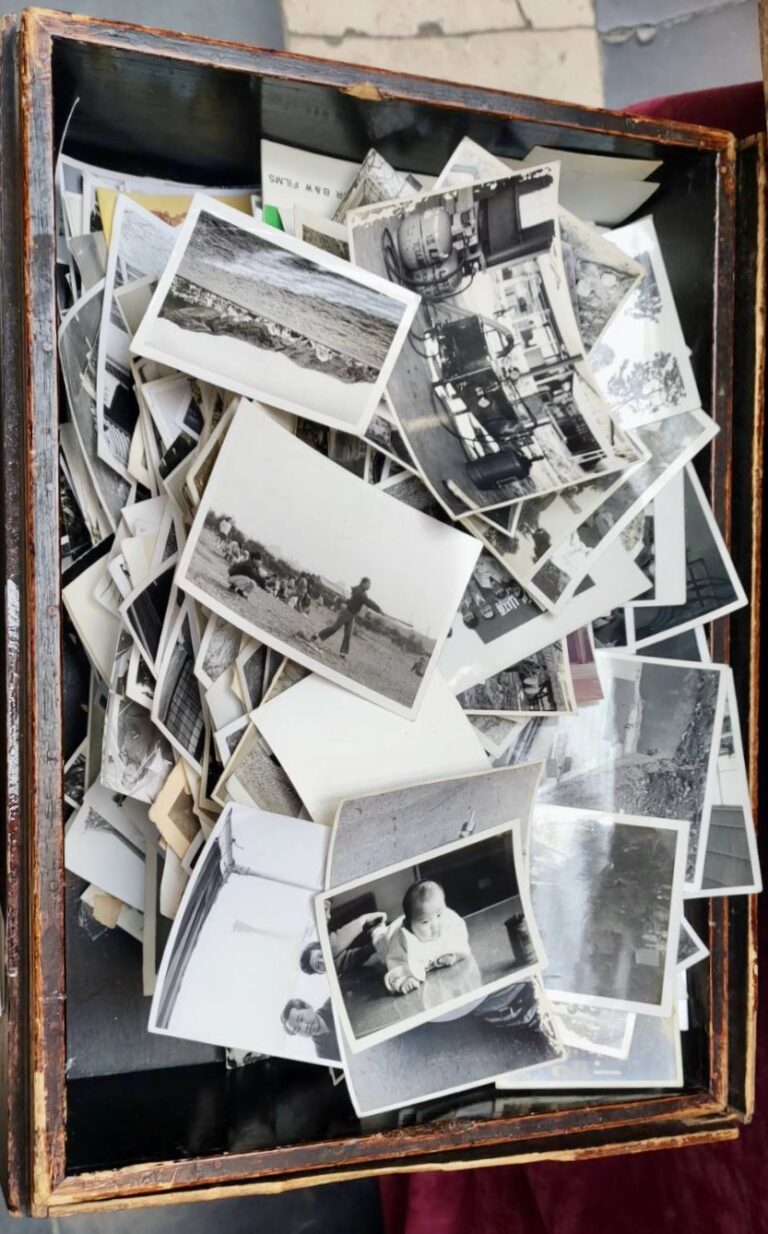Ich höre, also bin ich
Er hatte einen großen Einfluss auf die Musik im Nachkriegsdeutschland, aber auch später in seiner kreativen Arbeit über das Ohr und unser Hören. Er schlug eine Brücke zwischen Musik und Physik, Spiritualität und Philosophie – wie kommt es also, dass er fast vergessen scheint? Während er in seiner Hochphase nahezu allgegenwärtig war, ist er heute aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden.
Wir sprechen über Joachim-Ernst Behrendt (1922–2000), der Menschen inspiriert hat, über das Wunder des Hörens nachzudenken und bewusster zu hören. Er hat auch dazu eingeladen, die Stille zu suchen und wertzuschätzen: ein kostbares Geschenk in unserer lauten Welt.
Lessings „Qual des unerschöpflichen Lärms“
Bereits vor über 100 Jahren beklagte der deutsche Philosoph Theodor Lessing die Lärmbelästigung in Städten. Die „Qual und der Schmerz“ des „unerschöpflichen Lärms“ veranlassten ihn 1908 zur Gründung des ersten Deutschen Antilärm-Vereins (nach dem Vorbild der 1906 in New York gegründeten „Society for the Suppression of Unnecessary Noise“). In seinem Buch „Der Lärm. Eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens„ beklagt Lessing die ratternden Maschinen und ständig vorbeirollenden Bäckerwagen. Er beklagt feilschende Menschen in den Gassen, drängelnde Handwerker und streitende Kinder: „Alle seelische Kraft wird verbraucht, um diese ständigen Anspannungen zu bewältigen. Der Mangel an gesundem, tiefem Schlaf zerrüttet unsere Nerven.“ – Was Lessing vor über hundert Jahren (erst damals begannen sich Autos durchzusetzen) als subjektives Erleben niederschrieb, ist heute längst durch die Forschung belegt: Ständige Lärmbelastung kann gesundheitliche Folgen haben. Dazu gehören Schlaf-, Aufmerksamkeits- und Kommunikationsstörungen; zahlreiche Studien bringen chronische Lärmbelastung zudem mit Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen in Verbindung. Dauerhafter Lärm ist nicht nur lästig, sondern auch gesundheitsschädlich.
Es lohnt sich also, auf unsere Lärmbelastung zu achten, sie zu begrenzen – und genauer hinzuhören.
„Höre, so lebt deine Seele!“ – das war einer der Lieblings-Bibelsprüche von Joachim-Ernst Behrendts Vater. Und es war das Mantra, mit dem Berendt in der zweiten Hälfte seines Lebens durch die Hörsäle zog.
Doch schon in jüngeren Jahren setzte Behrendt einiges in Bewegung: Er brachte den Blues nach Europa, den deutschen Jazz in kommunistische Länder, er brachte Poesie und Jazz zusammen. 1953 veröffentlichte er „The Jazz Book“, das selbst in den USA zum meistverkauften Jazzbuch wurde. Seine Biographie scheint typisch für das Deutschland seiner Zeit – und dennoch so ungewöhnlich.
„Höre, so lebt deine Seele“
1925, als Joachim drei Jahre alt war, verließ sein Vater die Mutter. Es heißt, der Vater, ein Pfarrer habe sie davonjagt, und Joachim und seine Schwester blieben bei ihrem strengen Vater. Einsam und eingeschüchtert begann Joachim, den Garten zu untergraben, er baute im Laufe der Jahre ein Höhlensystem, das er sogar mit Strom versorgte, damit er Gedichte schreiben und Rilke, den Lieblingsautor seiner Mutter, lesen konnte. Sein Vater unternahm mit ihm lange nächtliche Spaziergänge und erklärte ihm die Sternbilder. Joachim wollte Physik studieren – und bloß nicht Pfarrer werden, wie sein Vater.
1942 wurde Berendt eingezogen. Er hockte in Bunkern und Schutzräumen – fast wie in dem Höhlensystem seiner Kindheit –, er las und schleppte Bücher mit sich herum. Während dieser Zeit war sein Vater in der Bekennenden Kirche, der Oppositionsbewegung protestantischer Christen gegen die Nazis, und wurde wiederholt verhaftet. Inzwischen kämpfte Behrendt, der Sohn, in Leningrad. Und aus Angst, von seinen Vorgesetzten in der Wehrmacht benachteiligt zu werden, verleugnete er seinen Vater, der zu diesem Zeitpunkt bereits im Konzentrationslager war.
Vielleicht trieb ihn all dies – der viel zu frühe Verlust seiner Mutter, Schuldgefühle, der Wunsch nach Wiedergutmachung, die Suche nach Sinn – sein Leben lang an. Sein Vater starb 1942 in Dachau. Dass Joachim-Ernst Berendt Leningrad überlebte, grenzte an ein Wunder, angesichts der Tatsache, dass fast seine gesamte Truppe umgekommen war.
Nach dem Krieg, 1949, reiste er für drei Monate in die USA. Er freundete sich mit Charlie Parker und John Hammond, dem großen amerikanischen Musikkritiker, an und besuchte eine Gospelkirche in Harlem. „Der Gottesdienst hatte kaum begonnen, da sang und schrie und tanzte ich schon mit, als hätte ich immer dazugehört“, sagte Berendt später.
„Wer swingt, marschiert nicht“
Zurück in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, begann in den 1950er Jahren die Rebellion gegen die Adenauer-Ära. Die Gesellschaft schien wieder zu verhärten und zu erstarren; sie musste wachgerüttelt werden. Für Berendt und andere wurde Jazz zum Inbegriff des Protests. Er produzierte wöchentliche Fernseh- und Radiosendungen mit Jazzkonzerten – insgesamt über 10.000 in all den Jahren.
Für ihn war Jazz eine politische Musik, eine Musik, die Individualität, Gleichheit, Freiheit, Demokratie, Toleranz und kulturellen Austausch betont. Er sagte immer wieder: „Wer swingt, marschiert nicht.“
1962 flog Behrendt nach Asien – nachdem monatelang im Rundfunkbüro ein Ticket gelegen hatte, ein Werbegeschenk von Pan Am, das niemand einlösen wollte. Als sich das Flugzeug über dem indischen Kontinent befand, wurde Berendt ohnmächtig, so gewaltig war für ihn diese Erfahrung. Er nannte diese Reise einmal „die größte Entdeckungsreise meines Lebens“, sie bedeutete für ihn nicht nur den Aufbruch zu einem neuen Kontinent, sondern auch eine Reise in sein Inneres.
Berendt blieb vier Monate in Asien. Und flog jedes Jahr zurück, insgesamt zwölf Jahre lang. Er war einer der ersten Europäer, die „Weltmusik“ produzierten – der diesen Begriff vielleicht sogar erst geprägt hat.
In den 1970er Jahren wandte sich Berendt zunehmend von der Jazzszene ab, um sich mit Musik im weiteren Sinne zu beschäftigen. In seinen späteren Jahren verstand er Musik stärker als Ausdruck der menschlichen Existenz selbst, verständlich erst im Kontext ihrer sozialen und religiösen Bezüge.
„Die Welt ist Klang“
1981 erschien seine Hörsoirée „Nada Brahma: Die Welt ist Klang“, zum Thema des Hörens aus medizinischer, historischer, kultureller, meditativer und philosophischer Sicht. Als ehemaliger Physikstudent thematisierte er auch magnetische, elektrostatische und andere physikalische Schwingungen. Als eine der wenigen Radiosendungen im Kulturprogramm erreichte dieses Feature ein großes Publikum und generierte über tausend Reaktionen.
In einem Zustand „großer Aufregung“ schrieb er daraufhin das Buch „Nada Brahma“, ein Plädoyer für eine neue Innenschau, für eine Abkehr von der Diktatur des Sehens, das durch seine expansive Natur gleichsam nach Beute greife „wie ein Adler“. Die Eigenschaften, die das Ohr beschreiben, stammen hingegen alle „aus dem Bereich des Empfangens, Aufnehmens und Sich-Öffnens“, so Berendt.
„Eine Gesellschaft, in der aufeinander gehört werde“, das wurde von nun an immer mehr sein Credo, „könne gar nichts anderes sein als eine liebevolle, rücksichtsvolle Gesellschaft“. Für Berendt war das Buch, als es endlich fertig war, „sein neuer Weg“.
Die Esoterik seiner Vorträge, die ehrfürchtige Atmosphäre, der ausschließliche Fokus auf das Zuhören sowie Berendts radikale Kritik am rationalen westlichen Denken – damit hatten seine Kritiker Probleme. Seine Hinwendung zum Philosophischen und Spirituellen, zum japanischen Zen-Buddhismus und zum indischen Mystiker Osho wurde von einigen seiner früheren Fans bedauert – von vielen anderen jedoch gefeiert.
Joachim-Ernst Berendt starb im Alter von 78 Jahren in Hamburg auf dem Weg zu einer Lesung, als er eine rote Ampel ignorierte und dabei angefahren wurde. Vielleicht passt es zu ihm, dass er sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hat, wenn sie für ihn gerade nicht zu passen schienen.
„Das Ohr ist der Weg“
In seinem Vortrag „Ich höre, also bin ich“ sagte Behrendt: „Wir leben in einer so einseitig visuellen Zivilisation, dass unsere anderen Sinne verkümmert sind, ja, auch unser Auge ist darüber gleich mitverkümmert. Es hat sich damit abgefunden, die Welt nur noch in Bildern und Abbildern wahrzunehmen, und es verwechselt die Bilder mit der Wirklichkeit. (…) Das Ziel ist das Gleichgewicht der Sinne. (…) in den großen alten Kulturen galt nicht das Auge, sondern das Ohr als unser edelster Sinn. “Das Ohr ist der Weg” heißt es in den Upanishaden, dem Grundbuch indischer Weisheit.
Für Berendt galt: „Ich höre, also bin ich“ – statt „Ich denke, also bin ich“. Das „Cogito ergo sum“ von Descartes hat das Abendland geprägt wie kein anderer Ausdruck. Dabei leben wir am intensivsten, wenn wir nicht denken – in der Natur, am Meer oder auf einem Berg, in der Kunst, der Musik, in der Liebe …
Der Satz von Descartes führte zur Trennung von Denken und Körper, und zur Getrenntheit von anderen Lebensformen: All die anderen Lebewesen, die nicht zu denken scheinen, haben nicht die gleiche Existenzberechtigung wie wir Menschen. Behrendt sprach schon in den 1980er Jahren davon, dass täglich 47 Arten ausgerottet werden – heute sind es Schätzungen zufolge täglich 130 bis 150 Arten, und laut International Union for the Conservation of Nature (ICUN) ist etwa jede vierte Säugetierart auf dem Land und jede dritte im Meer vom Aussterben bedroht.
„Ich denke, also bin ich“ – ist der Mensch am Ende der Einzige, der übrig bleibt? Es ist eindrücklich, dass schon Joachim-Ernst Behrendt die Einsamkeit des modernen Menschen auf unserem Planeten thematisierte.
„Ich höre, also bin ich“ hat ihm zufolge eine ganz andere Wirkung. Das Wunder und die Schönheit unseres Hörvermögens zu entdecken, lädt uns zu Demut und Ehrfurcht ein – und zur Abkehr von unserer dominierenden, destruktiven und ausbeuterischen Lebensweise.
Das Ohr – der erste und der letzte unserer Sinne
Was für ein Wunder das Hören ist, zeigt uns die Physiologie und Entwicklung des Ohrs: Ein Embryo hat bereits 7–8 Tage nach der Befruchtung mikroskopisch kleine Ohransätze. Viereinhalb Monate nach der Befruchtung sind Cochlea und Labyrinth vollständig entwickelt und haben bereits ihre endgültige Größe erreicht.
Und am Ende des Lebens ist der letzte Sinn, der stirbt, meist der Hörsinn. „Wenn wir aufhören zu hören, hören wir auf zu existieren“, formulierte es Behrendt. Der Hörsinn entwickelt sich zuerst und verschwindet zuletzt im menschlichen Leben.
Das Ohr ist unser empfindlichster Sinn, dem Auge und den anderen Sinnen um ein Vielfaches überlegen. Wir können fast siebenmal schneller hören als sehen. Könnten wir so schnell sehen wie wir hören, würden wir in Filmen nur Punkte und Linien sehen.
Wir können das Rauschen unserer eigenen Zellen hören – wir können sozusagen hören, dass wir leben. Behrendt entwirft Assoziationen zwischen Muscheln am Meer und dem Außenohr, er beschreibt das Bild eines Kindes, das ehrfürchtig eine Muschel ans Ohr hält und dem Rauschen lauscht, wie ein Embryo dem Rauschen im Mutterleib. Und immer wieder schlägt Behrendt eine Brücke zu Stille, Meditation und Spiritualität. Zum Hören, nach außen wie auch nach innen.
„Unsere einseitige Augenherrschaft hat uns zu jener Aggressivität programmiert, die das auffälligste Kennzeichen der westlichen Menschheit ist. Das Ohr aber programmiert uns zu einer rezeptiven, aufnehmenden, weiblichen, hingebenden Haltung – also genau zu der Haltung, die wir heute, wenn wir auf dieser Erde überleben wollen, nötig haben. (…) Der neue Mensch wird ein hörender sein – oder er wird nichts sein. Das Ohr ist der Weg.“
„Das Ohr ist der Weg“ – das mag vielen heute zu apodiktisch erscheinen, doch es lohnt sich dennoch, die Qualitäten des Hörens bewusster wahrzunehmen, so wie es auch Ian McGilchrist einmal beschrieben hat:
„Das Erlebnis des Musikhörens ist ein „Dazwischen“. Ist es einfach da draußen, für sich allein? Ganz sicher nicht. Ist es also nur in meinem Gehirn? Ganz sicher nicht. Es existiert nur, wenn Äußeres und Inneres zusammenkommen: das heißt, es liegt im „Dazwischen“. Erfahrung – Geist – ist immer dazwischen. Und ich glaube, die ganze Realität ist so – eine Verbundenheit, Verwobenheit, nicht wie Decartes´ Sicht der Getrenntheit.“