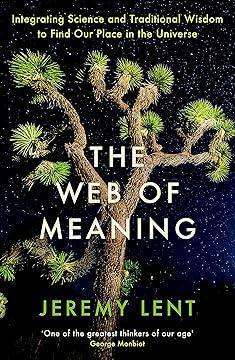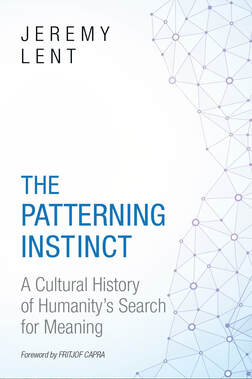Das Netzwerk des Lebens
In seinem Buch „The Web of meaning“ beschreibt Jeremy Lent eine Gesprächssituation, die wir wohl alle kennen; eine „Rede“, die wir alle in irgendeiner Form schon einmal gehört haben: „Sie haben sie wahrscheinlich schon oft gehört. Vielleicht sogar schon selbst gehalten. Jeden Tag werden weltweit unzählige Versionen davon gehalten, von Leuten, die zu wissen scheinen, wovon sie sprechen.“
Bei einem Familientreffen zum Beispiel. „Es ist Teezeit und ein paar von uns unterhalten sich über den Zustand der Welt. Jemand kommentiert, was mit unserem System nicht stimmt und wie viel besser alles sein könnte (…) „Seien wir ehrlich“, erklärt Onkel Bob, „da draußen herrscht ein gnadenloser Wettbewerb. Jeder ist sich selbst der Nächste. Was nützen die schönen Ideen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, am Ende geht es allen nur um die eigene Haut. So funktioniert die ganze Natur. So wurden wir programmiert.“
Im Kern, so Jeremy Lent, wird diese Botschaft weitergegeben: Menschen sind egoistische Individuen. Egoistische Gene sind die treibende Kraft der Evolution. Die Natur ist einfach eine hochkomplexe Maschine, und der menschliche Einfallsreichtum hat größtenteils herausgefunden, wie sie funktioniert. – Wie kam es dazu, dass wir die Erde und Lebewesen so sehen und erleben, als Dinge, und als Ressourcen, die wir ausbeuten? So dass wir selbst von „menschlichen Ressourcen“ sprechen, die zu Kapital werden können? Unsere Orientierung, uns hauptsächlich auf Wissenschaft und Technologie zu verlassen, verschafft uns Fortschritt und Komfort, wir verlieren aber aus dem Blick, was für ein gutes Leben sinn- und wertvoll ist.
Von der Gentechnik bis zum Geo-Engineering behandeln wir die Natur wie eine Maschine. Dieses Verständnis ist tief im westlichen Denken verwurzelt. Die komplexen, emergenten Prozesse im Körper beschreiben wir als „Regulationsmechanismen“, „genetische Mechanismen“, „Fortpflanzungs-Mechanismen“; wir bezeichnen unser Gehirn als „Hardware“ – als ob darin Computerprogramme ablaufen würden.
Jeremy Lent, den George Monbiot (The Guardian) „einen der größten Denker unserer Zeit“ nennt, sieht sich selbst als Autor und Integrator. Er erforscht die Ursachen der existenziellen Krise unserer Zivilisation und sucht nach Wegen in eine dem Leben zugewandte Zukunft.
Die These vom „egoistischen Gen“
In „The Web of meaning“ behandelt Lent das oben beschriebene mechanistische Narrativ und die weitreichenden Folgen für unsere Gesellschaft. Einen großen Einfluss hat und hatte Richard Dawkins, Britischer Evolutionsbiologe und populärwissenschaftlicher Autor, mit seiner These vom „egoistischen Gen“:
„Kurz gesagt, die zugrunde liegende Geschichte lautet ungefähr so: Alle Organismen in der Natur sind lediglich Gefäße für die Replikation der egoistischen Gene, die uns kontrollieren. Daher sind alle Lebewesen – einschließlich des Menschen – dazu getrieben, rücksichtslos um die Weitergabe ihrer Gene zu konkurrieren. Dieser Kampf um Fortpflanzung ist der Motor der Evolution. (…) Jedes scheinbar altruistische Verhalten ist lediglich eine bequeme Taktik für ein verborgenes egoistisches Ziel. Da die Natur am effektivsten auf Egoismus basiert, sollte die menschliche Gesellschaft ähnlich organisiert sein, weshalb der freie Marktkapitalismus alle anderen sozioökonomischen Modelle so erfolgreich dominiert hat.“ Jeremy Lent in „The Web of Meaning“
Dawkins spricht davon, dass wir uns, um unsere egoistischen Gene zu überwinden, zu Großzügigkeit und Altruismus erziehen müssten – da wir eben von Natur aus egoistisch seien. Obwohl die Idee des „egoistischen Gens“ nach wie vor gesellschaftlich präsent ist, gilt sie inzwischen als überholt und widerlegt.
Epigenetik – die Farbpalette der Natur
Die genetische Ausstattung wird heute eher wie die Farbpalette eines Künstlers gesehen: Sie steht zur Verfügung, aber natürlich gestaltet nicht sie das Gemälde. Welche zellulären Prozesse die Aktivität von Genen beeinflussen, erforscht die Epigenetik.
Lent nennt ein anschauliches Beispiel für epigenetische Einflüsse: Manche Heuschrecken, harmlose, gut getarnte Einzelgänger, verwandeln sich unter bestimmten Umständen in kürzester Zeit in aggressive Insektenschwärme, die ganze Regionen überfallen und kahlfressen. Die gleiche DNA führt also durch epigenetische Einflüsse zu völlig anderem Verhalten der Heuschrecken und auch – da sie plötzlich andere, giftige Pflanzen fressen – zu anderem Aussehen mit gelber Warnfarbe.
Dass die DNA unser Verhalten determiniert, ist also inzwischen widerlegt. Jeremy Lent führt weiter aus: „Theoretiker zeichnen ein Bild der Evolution als eine Reihe komplexer, ineinander greifender Systeme, in denen Gen, Organismus, Gemeinschaft, Art und Umwelt über verschiedene Zeiträume hinweg auf vielfältige Weise miteinander interagieren. Und was unsere intrinsische menschliche Natur betrifft, hat eine neue Generation von Wissenschaftlern unsere Fähigkeit zur Kooperation statt zur Konkurrenz als unser bestimmendes Merkmal hervorgehoben.
Dies ist eine entscheidende Entdeckung, die zu einem festen Bestandteil der modernen Molekularbiologie geworden, aber noch nicht ins öffentliche Bewusstsein gelangt ist. Sie bedeutet, dass die Beziehung zwischen Genen und Organismus nicht einseitig, sondern zirkulär ist. Die DNA kann nichts allein tun – sie funktioniert nur, wenn bestimmte Teile durch die Aktivitäten verschiedener Proteinkombinationen, die selbst durch die Anweisungen der DNA gebildet wurden, ein- oder ausgeschaltet werden. Dieser Prozess ist ein lebendiger, dynamischer Kreislauf der Interaktivität.“
Wenn wir uns also genauer mit diesen Prozessen und Phänomenen befassen, wird noch einmal deutlicher, wie absurd es ist, Organismen mit Maschinen gleichzusetzen: „Eine Maschine ist statisch, bis sie eingeschaltet wird, und kann ausgeschaltet werden, ohne aufzuhören zu existieren. Organismen haben keinen Ausschalter. Die Existenz eines Organismus ist von Anfang bis Ende ein unaufhörlicher Fluss und Austausch von Materie und Energie. Ein Stillstand, auch nur für einen Augenblick, würde den sofortigen Tod bedeuten. Sie können Ihren Computer im Büro lassen und einen Monat später zurückkehren und ihn wieder benutzen. Aber wenn Sie Ihren Hamster versehentlich dort lassen, werden Sie ihn nicht mehr lange haben.“ Iain McGilchrist „The Matter with Things : Our Brains, Our Delusions, and the Unmaking of the World“ 2021.
Wir sind nicht nur vollständig in der Natur, sondern die Natur ist vollständig in uns; wir sehen, dass Menschen keine isolierten oder isolierten Akteure in der Welt sind, sondern in die Umwelt eingetaucht, von ihr angetrieben und in Kontakt mit ihr. Interdependenz bedeutet mehr als nur Interaktion, es ist viel mehr unsere eigentliche Konstitution: Wir entstehen erst durch die Interaktion mit unserer Umwelt.
Selbst unsere DNA gehört nicht nur uns
Jeremy Lent geht mit der folgenden Beschreibung der Zellen, aus denen wir bestehen, noch tiefer auf die Vernetzung des Lebens ein:
„Das früheste Leben bestand aus einzelnen Zellen, Prokaryoten, die den Bakterien, die seither auf der Erde gedeihen, sehr ähnlich sind. (…) Etwa eine Milliarde Jahre lang geschah nicht viel, außer dass sich eine bestimmte Bakterienart zu vermehren begann und im Rahmen ihres Stoffwechsels Sauerstoff in die Umwelt freisetzte. Dieser Neuzugang in der Atmosphäre war für viele frühe Zellen giftig und verursachte das erste Massenaussterben auf der Erde. Etwa zu dieser Zeit trat ein neuer Zelltyp auf den Plan. Beim so genannten Eukaryot (griechisch für „echter Kern“) befand sich das gesamte DNA-Material in einem Zellkern (und nicht wie bei Prokaryoten im Zytoplasma).
Eukaryoten fanden eine neuartige Nahrungsquelle: Sie nutzten ihre flexibleren Zellwände, um andere Bakterien zu umschließen und aufzunehmen, wobei ihre Bestandteile als Nahrung zerlegt wurden. Doch dann geschah etwas ziemlich Seltsames – und das wahrscheinlich mehr als einmal. Ein Eukaryot verschlang einen Prokaryoten, und anstatt ihn zu verdauen, begannen sie zusammenzuarbeiten. Dieser spezielle Prokaryot war ein winziges Kraftwerk, spezialisiert darauf, Sauerstoff – heute allgegenwärtig – aufzunehmen und in Energie umzuwandeln. Die sogenannten Mitochondrien bildeten eine Beziehung zu Eukaryoten, die als die erfolgreichste Partnerschaft der Welt gelten könnte. Jeder Organismus, den wir um uns herum sehen – jede Pflanze, jedes Insekt, jedes Tier – besteht aus eukaryotischen Zellen, die Hunderte, manchmal Tausende von Mitochondrien enthalten (bei Pflanzen heißen sie Plastiden), die die Energie produzieren, die die Zelle benötigt, um ihre Arbeit zu verrichten. Bis heute tragen Mitochondrien ihre eigene DNA in sich, mit der sie sich getrennt vom Rest der Zelle replizieren.“
Die Zusammenarbeit zwischen Eukaryoten und Mitochondrien wird von vielen Biologen als eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des Lebens auf der Erde angesehen.
„Das Leben eroberte die Welt nicht durch Kampf, sondern durch Vernetzung.“ Evolutionsbiologin Lynn Margulis
Zellnetzwerke bilden unsere Organe, und sie arbeiten auf äußerst harmonische Weise zusammen: Keine Konkurrenz oder egoistisches Verhalten: Eine egoistische Leber, die mit Herz oder Lunge konkurriert, würde einen schnellen Tod bedeuten. Natürlich steht außer Frage, dass auch der Wettbewerb und Überlebenskampf eine zentrale Rolle im Drama des Lebens spielt. Wie können wir das mit den Kräften der Kooperation in Einklang bringen?
Ein Ökosystem entsteht aus Organismen, die in einem komplexen Zusammenspiel von Wettbewerb und Kooperation zusammenwirken: ein harmonischer Tanz des Lebens. Tatsächlich ist die kreative Spannung, die daraus entsteht, selbst eine treibende Kraft der Evolution. Und: „Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, die elegant komplexe Verflechtung natürlicher Prozesse, die ein Ökosystem ausmachen, zu beschreiben: Harmonie.“ Lynn Margulis
Nicht Materie, sondern Beziehung schafft Bedeutung
Was hat das nun alles mit dem Sinn zu tun, den wir im Leben suchen?
So wie Musik ein emergentes, also unerwartetes, neu auftretendes, im Moment entstehendes Phänomen zwischen Musikern und Zuhörern ist, so ist Sinn ein emergentes Phänomen und Erleben, das aus Zusammentreffen, Zusammenspiel, der Erfahrung von Verbundenheit und tiefem Kontakt entsteht.
Auf die Frage „Was bin ich?“, die wir uns alle irgendwann stellen, gibt Lent die überraschende Antwort: Ich bin ein robustes Muster sich selbst organisierender Kooperation. Was damit gemeint ist, beschreibt er so:
Denken wir zum Beispiel an ein Foto von uns selbst als kleines Kind. Wir wissen, dass wir das sind, haben vielleicht sogar die Erinnerungen daran. Und doch unterscheidet sich all das, woraus dieses Kind besteht, jede Zelle in diesem Kind, von den Zellen des heutigen Ichs.
Es gibt einige Zellen im Körper, die tatsächlich unser ganzes Leben lang in unserem Körper bleiben, aber selbst diese Zellen verändern ständig ihre Bestandteile. Was uns also mit diesem kleinen Kind verbindet, sind die Prinzipien der Organisation, die Art und Weise, wie die Elemente miteinander in Beziehung stehen. Das bewirkt die Kohärenz der Identität in unserem Erleben. Das bewirkt, dass die Erinnerungen, die wir haben, stabil bleiben. Unsere Identität bleibt mit diesem kleinen Kind verbunden durch die Wechselwirkungen zwischen den Elementen. Die Verbindung zwischen den einzelnen Elementen ist insofern wichtiger als die Elemente selbst.
Von da aus entwickelt Lent sein Verständnis von Sinn und Bedeutung: In komplexen Systemen entsteht eine zunehmender Anzahl von Verbindungen, und dadurch entstehen neue Bedeutungen – so zum Beispiel, wenn Neuronen sich verbinden, so dass Bewusstsein möglich wird. Wenn Organismen sich verbinden, so dass ein Ökosystem entsteht. Wenn Wörter sich zu Sprache verbinden und dabei Sinn entsteht. Wenn einzelne Noten sich zu einer Melodie verbinden. Und so weiter … Bedeutung und Sinnhaftigkeit entsteht somit, wenn wir neue Verbindungen schaffen.
Auch der Physiker Nils Bohr beschrieb, „dass „ein „Ding“ nur im Kontext einer Beziehung ein „Ding“ ist. Ändert man die Beziehung, verändert sich das „Ding“. Mit anderen Worten: Es gibt keine Dinge, nur Verflechtungen, nur Beziehungen – und eine Verflechtung ist keine Aneinanderreihung bereits bestimmter Wesenheiten. Sie ist eine fortwährende Promiskuität, welche „Dinghaftigkeit“ erst ermöglicht, den Walzer tausender Un-Möglichkeiten und die Welt, die in sich und mit sich selbst verschmilzt …“
Noch einmal Jeremy Lent: „Wir könnten also auch vom Leben als einem vernetzten, sich vereinenden, aktiv selbstorganisierten Prozess sprechen, der Rhythmus und Harmonie ausstrahlt und der ein Gefühl der Ganzheit ausdrückt und untrennbar mit Werten, Sinn und Zweck verbunden ist – die jeweils einzeln und gemeinsam zum Phänomen der Selbstverwirklichung führen.“ Und: „Im Grunde erzeugt alles, was wir im Leben tun, Wellen, die sich auf alles andere im Universum auswirken und zu diesem Grundprinzip der ultimativen Verbundenheit von allem im Kosmos führen. Wir existieren also in einem Ozean.“
Wir empfehlen beide Bücher von Jeremy Lent, auch wenn es sie leider (noch) nicht auf Deutsch gibt. Sehr empfehlenswert sind auch die Artikel auf seiner Webseite und seine Vorträge auf Youtube (die Untertitel lassen sich bei Youtube in den Einstellungen auf Deutsch übersetzen).