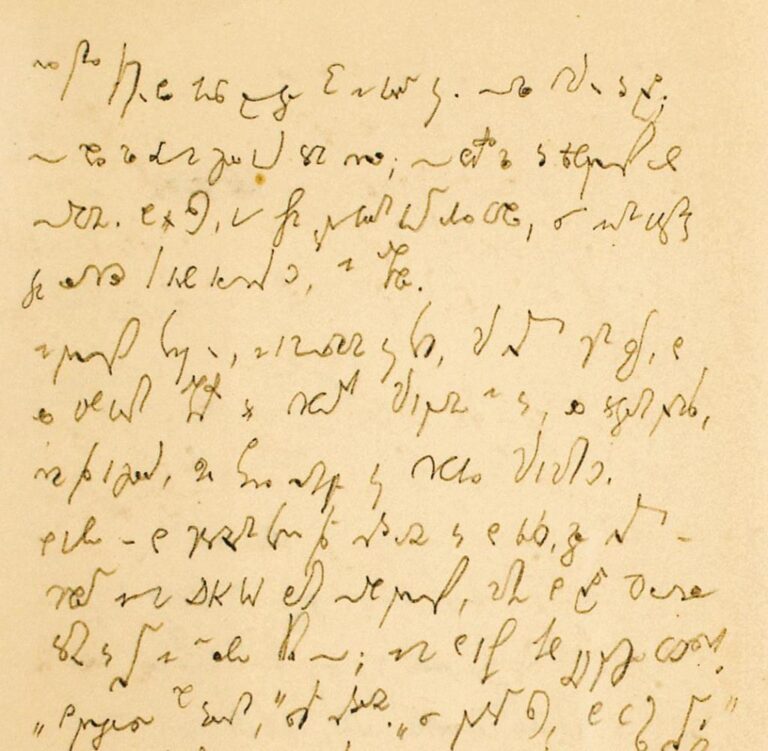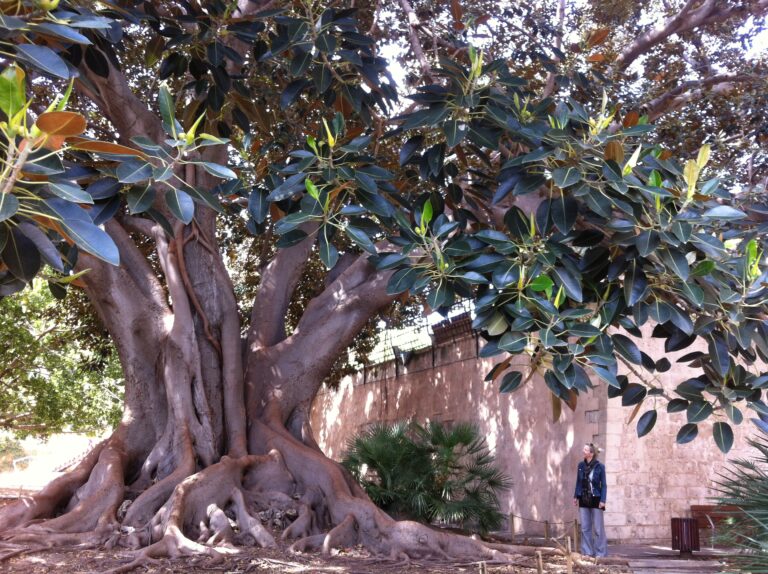Paul Tillich und der Mut zum Sein
Liebe und Mut gehören zusammen. Mut ist eine Eigenschaft des offenen Herzens: Es ist seine Stärke. Liebe ist nicht schwach. Das Wort Courage kommt vom altfranzösischen Wort „coeur“ für „Herz“. Mut ist Ausdruck unserer aufrichtigen, engagierten Teilhabe an der Welt. Menschen gehen in ihrem Leben ständig mutige Wege: In ihren Beziehungen, in ihrer Arbeit, in ihren Entscheidungen und mit sich selbst.
David Whyte, ein zeitgenössischer Dichter und Philosoph, schreibt: „Es gibt keine Ehe, egal wie glücklich, in der wir nicht manchmal Krisen erleben, die uns das Herz brechen. Wenn man eine Familie gründet, kann man keine gute Mutter oder kein guter Vater sein, ohne dass ein Kind einem mal das Herz bricht. … (…) Daher kann dies ein liebevoller und wertvoller Gedanke sein: Eigentlich gibt es keinen Weg, den ich gehen kann, ohne dass mir das Herz gebrochen wird. Warum also nicht einfach das Leben leben und aufhören, es besser und besonders haben zu wollen – was mich davon abhält, etwas Mutiges zu tun?“
Und Joanna Macy:
„…Liebe meint nicht nur Verschmelzung. Sie ist ein Aufruf, eine edle Berufung für jeden Einzelnen, zu reifen, sich auszudifferenzieren, selbst zu einer eigenen Welt zu werden in der Antwort auf andere …“
Diese „edle Berufung“ weist auf einen Aspekt der Liebe hin, den wir manchmal vergessen oder unterschätzen – es geht um die Fähigkeit, mutig auf die Welt und auf andere zu reagieren, wie Joanna Macy es oft formuliert hat.
Welches Leben macht Sinn und erfüllt uns? Wenn Liebe eine der Eigenschaften ist, die unser begrenztes Leben hier auf Erden lebenswert macht: Warum sollten wir ihr nicht den Vorzug vor all den Dingen geben, denen wir normalerweise nachjagen? Um ein Leben im Einklang mit unseren tiefen Werten zu führen – in einer Welt, in der diese Werte bedroht sind – brauchen wir immer wieder Mut. Wir müssen für sie eintreten und auch den Mut haben, Nein zu dem zu sagen, was diese Werte bedroht.
Paul Tillich: „Der Mut zum Sein“
Paul Tillich war einer der bedeutendsten protestantischen Theologen und Religionsphilosophen des 20. Jahrhunderts. Sein leidenschaftlicher Einsatz für die Freiheit machte ihn zu einem frühen Kritiker Adolf Hitlers und des Nationalsozialismus.
Paul Tillich war der erste nicht-jüdische Hochschullehrer, der 1933 ein Berufsverbot von den Nazis erhielt. So musste er die Universität Frankfurt verlassen – „ich war der erste nichtjüdische Akademiker, dem diese Ehre zuteil wurde“, formulierte er es später ironisch.
Seit den 1920er-Jahren gehörte er zum Kreis der „Religiösen Sozialisten“, die soziale Gerechtigkeit statt kirchlich institutionalisierter Fürsorge forderten. Tillich schrieb: „Es ist ein höheres Ziel, die Voraussetzungen des Almosengebens aufzuheben, als die Armut durch Almosen zu lindern.“
1929 trat Tillich in die SPD ein. In seiner Schrift „Die sozialistische Entscheidung“ griff er auch die Nationalsozialisten an, so dass das Buch 1933 auf der Liste für die Bücherverbrennungen stand. Seine Unterstützung für jüdische Mitmenschen, sein religiöser Sozialismus und sein Engagement als Dekan der Frankfurter Universität, gewalttätige nationalsozialistische Studenten auszuschließen, führten zu Tillichs Entlassung. Er entging nur knapp einer Verhaftung und konnte, mit Einladung der Columbia University, in die USA auswandern. Von diesem sicheren Hafen in New York aus organisierte und leitete er Hilfsprogramme für Emigranten aus Mitteleuropa, die in den 1930er Jahren vor den Nazis flohen und in die USA emigrierten.
Als politischer Theologe an der Yale University nahm er 112 Radiosendungen in deutscher Sprache auf, die von März 1942 bis Mai 1944 im besetzten Europa ausgestrahlt wurden. Selbst seine engsten Freunde in den USA wussten nichts von dieser geheimen Arbeit für die Alliierten.
1952 schrieb er sein bis heute meistgelesenes Buch Der Mut zum Sein. Darin spricht er über eine Art existenziellen Mutes, der es uns letztlich ermöglicht, Sinnlosigkeit zu konfrontieren und zu überwinden.
„Im Mut liegt Weisheit“, schreibt er, und: „Der mutige Mensch durchschaut die Illusion und die Verzerrung durch die Angst oder die Not, und erkennt das wirklich Gute und handelt entsprechend.“
Tillich schreibt über das „Zeitalter der Angst“, das wir auch heute noch erleben. Einer der wichtigsten Ansätze dieses Buches ist die Analyse unserer menschlichen Angst, die er in drei Facetten beschreibt:
– die ontologische Angst, Angst vor dem Tod (Nichtsein) und unserem endgültigen Schicksal
– die spirituelle Angst aufgrund von Verzweiflung und Sinnverlust
– und die moralische Angst, Angst vor Schuld und Verdammnis durch unsere unvermeidliche Verstrickung in menschliches moralisches Fehlverhalten
Mut ist seiner Ansicht nach die ehrliche und bewusste Auseinandersetzung mit diesen Ängsten, und die Entscheidung, das eigene Sein angesichts des Verlusts von Werten zu behaupten – Werten wie Sicherheit und Vertrauen in Autoritäten, demokratischen Werten, der Sinnhaftigkeit der Lebensumstände.
Der Mut, trotz und angesichts der Angst zu bestehen
Dies gilt sicher für seine damalige Zeit ebenso wie für uns heute. Oft wollen wir Gefühle wie Angst und Bedrohung nicht spüren und verschließen unser Herz vor ihnen. Das ist menschlich, es bedeutet aber auch, dass wir in Abwehrmechanismen und Reaktivität gefangen sind. Wir sind nicht ganz da, nicht ganz bei uns, und in gewisser Weise wollen wir ja auch nicht ganz – nicht mit all diesen schwierigen Gefühlen – da sein.
Tillich ermutigt uns jedoch, Angst, Verzweiflung und Sinnlosigkeit auf uns zu nehmen, um dadurch vollständiger zu leben. Im Englischen beschrieb er dies als „to take it upon oneself“. Das Wörterbuch offeriert mehr als 20 Synonyme im Deutschen dafür – deren Zusammenfassung könnte lauten: Es ist ein Aufruf für jeden Einzelnen, sich der Herausforderung und den Ängsten zu stellen, sich einer Sache zu verschreiben, sich zu engagieren, sich auf die Situation, die Fragen, die Gefühle tief einzulassen, sie zu erforschen und daran zu reifen.
Dieses Engagement, so Tillich, ist der Mut, trotz und angesichts der Angst zu bestehen.
Mut ist unsere engagierte Teilnahme am Leben, an anderen, an einer Gemeinschaft, an unserer Arbeit, an unserer Zukunft; er ermöglicht, den Notwendigkeiten unserer Beziehungen gerecht zu werden und uns auf Dinge einzulassen, die uns am Herzen liegen: auf die Bedürfnisse eines Menschen, auf die Gesellschaft. Dabei ist Mut nicht blind: Es braucht die Weisheit, ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Kühnheit und Feigheit zu finden, wie schon Aristoteles es formulierte.
Wir möchten ein Beispiel für diese Qualität des Mutes nennen: Dr. John Gartners und Dr. Harry Segals Podcast „Shrinking Trump“ (beide sind Psychiater, „shrinks“). Sie stellen sich mit ganzem Herzen all diesen zerstörerischen Angriffen auf grundlegende menschliche Werte in den Vereinigten Staaten und zeigen dabei offen ihre Gefühle, die Angst und Wut, und wie sie damit umgehen.
Unser aller Mut liegt darin, authentisch zu sein, präsent zu bleiben und unsere persönliche Antwort auf die Herausforderungen und die Krise zu finden, selbst wenn schwierige Gefühle wie Hilflosigkeit oder Angst aufkommen: dann möchten wir uns vielleicht durch Vermeidung und Abschottung verteidigen. Wir glauben, dass uns das vor Gefahren schützt, aber in Wirklichkeit schützt es uns nur vor der wahrgenommenen Bedrohung durch emotionalen Schmerz.
Doch mit einem verschlossenen Herzen verlieren wir – ohne es zu merken – auch den Zugang zu den Qualitäten eines offenen Herzens: den Mut und die Kraft, kontaktfreudig für uns selbst einzustehen; wir verlieren auch die liebevolle Güte für uns selbst und die Wertschätzung des anderen. Paul Tillich blieb bis ins hohe Alter offen, auch für andere Sichtweisen und Religionen.
So schrieb er: „Ich war in Japan, wo ich zehn Wochen mit Buddhisten debattiert habe. Man muss verstehen, dass in jeder aktuellen Religion Elemente von dem enthalten sind, was auch in jeder anderen aktuellen Religion vorkommt. Wenn man darum mit einem Buddhisten spricht, dann spricht man immer zugleich mit sich selbst.“
Diese Offenheit hat er auch grundlegend als Selbstverständnis formuliert:
„Ich fühle mich zwischen den Welten. Und ich bejahe diese Stellung, weil sie mit dem christlichen Grundgedanken, dass wir Pilger auf Erden sind, sehr viel Ähnlichkeit hat. (…) Das Dasein auf der Grenze, die Grenzsituation, ist voller Spannung und Bewegung. Sie ist in Wirklichkeit kein Stehen, sondern ein Überschreiten, ein Zurückkehren, ein Wieder-zurück-kehren, ein Wieder-überschreiten, ein Hin und Her, dessen Ziel es ist, ein Drittes, jenseits der begrenzten Gebiete zu schaffen.“
Hier der Link zu Paul Tillichs Rede, die er 1962 bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels gehalten hat.